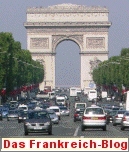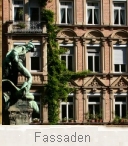Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (II)
25. November 2007 von H. Wittmann
Il manque encore une sociologie de l’Internet, et mes remarques en session avec Robert Basic lors du > Barcamp in Mannheim étaient une tentative d’ouvrir le sujet des réseaux sociaux d’une autre manière.
La thése :
Les échanges, les téléportations, les propositions d’amitié, les contacts et la distribution de petits cœurs, tout cela aboutit à des relations documentées qui reflètent une culture personnelle qui n’a rien à voir avec un public ou des relations sociales publiques, parce que la prise de contact électronique est éphémère, permet de se retirer à tout moment et n’exige qu’un faible degré de responsabilité pour la nouvelle relation. – Pourquoi un souhait de contact est-il exprimé ? Veut-on remplir sa propre liste de connaissances, veut-on soi-même devenir plus connu ? Combien de contacts peut-on supporter ? Ne pas répondre à une demande de contact est très simple, l’autre n’en est pas informé. Dans ce genre de jeu, nous permettons à une tierce instance de régler notre relation, qui n’en est pas encore une. Ce n’est qu’un petit aspect de tout un réseau où non seulement mon contact, mais aussi l’exploitant du réseau et même la communauté du réseau interviennent dans les possibilités d’organisation de mes relations de contact. Si l’on réfléchit au nombre de types de règles qui régissent les forums, la possibilité d’organiser personnellement une prise de contact semble étrangement limitée.
Est-ce que je perçois l’autre uniquement sur la base des qualités qu’il affiche ? Une personne n’est-elle pas justement intéressante parce qu’elle réagit de manière merveilleusement individuelle et incomparable, unique, dans une situation donnée, quelque chose que son profil ne reproduira jamais. Les gens mettent leur profil en ligne et deviennent étrangement anonymes. Aucun profil sur les réseaux sociaux ne permet de pondérer les intérêts personnels dans un profil. Ce n’est d’ailleurs pas nécessaire, le profil donne la même forme pour tous, après tout, chaque visiteur veut pouvoir s’orienter de la même manière sur chaque page, conformément à l’usabilité. Il en résulte une uniformisation dont les conséquences sont encore obscures.
 Il est peut-être possible d’aborder ce problème par le biais de l’architecture ou de la planification urbaine. Considérons successivement deux places qui doivent constituer l’espace de la vie publique. La Wihelmsplatz (I) à Stuttgart-Bad-Cannstatt (> Eine Ortsbesichtigung) iest le premier exemple. Ici, la création d’un espace public permettant aux gens de se rencontrer a été un véritable échec. Il est évident qu’une multitude de réglementations de toutes sortes réduisent les trajets des personnes à un espace restreint, alors que les autres usagers de la route ont obtenu leurs propres espaces de circulation.
Il est peut-être possible d’aborder ce problème par le biais de l’architecture ou de la planification urbaine. Considérons successivement deux places qui doivent constituer l’espace de la vie publique. La Wihelmsplatz (I) à Stuttgart-Bad-Cannstatt (> Eine Ortsbesichtigung) iest le premier exemple. Ici, la création d’un espace public permettant aux gens de se rencontrer a été un véritable échec. Il est évident qu’une multitude de réglementations de toutes sortes réduisent les trajets des personnes à un espace restreint, alors que les autres usagers de la route ont obtenu leurs propres espaces de circulation.




Les piétons ne sont tolérés sur cette place que dans la mesure où ils sont prêts à la traverser rapidement entre les grilles de passage. Ce n’est pas un lieu où l’on peut s’attarder. En tant que centre d’un quartier, elle a perdu sa fonction.


Les réseaux sociaux comme Facebook et autres fonctionnent de la même manière sur Internet. Malgré un nombre toujours plus grand de fonctions qui offrent une multitude de possibilités pour se présenter, le schéma de la prise de contact est largement imposé par les concepteurs de ces réseaux, exactement comme sur une place où les gens doivent se déplacer selon des trajectoires prédéfinies. Qu’est-ce qui vient à l’esprit sur cette place ? Comment les passants pourront-ils se réapproprier cet espace urbain ?
Bonne question, surtout un week-end comme celui-ci, où les habitants d’Ulm visitent le musée Weishaupt à > Ulms Neuer Mitte, > Drei neue Gebäude, a été inauguré.

Photo (c) Ville d’Ulm. Avec l’aimable autorisation de la ville d’Ulm.
Le nouveau musée se trouve directement sur la place Hans-et-Sophie-Scholl, avec laquelle les habitants d’Ulm ont enfin refermé de manière très impressionnante les blessures de guerre de la ville, que la Neue Straße rappelait encore récemment, entre la cathédrale et la vieille ville.
Outre les avantages évidents qu’offrent les réseaux sociaux, leur fonctionnement et leur structure peuvent être critiqués.
Le deuxième exemple : > La Place de l’Homme de fer in Straßburg
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (I)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (II)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (III)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (IV)
Eine Soziologie des Internets fehlt noch, und meine Bemerkungen in Session mit Robert Basic auf dem > Barcamp in Mannheim waren ein Versuch, das Thema Soziale Netzwerke mal auf eine andere Art zu öffnen.
Die These:
Kuscheln, anbeamen, Freundschaften vorschlagen, Kontakte knüpfen und Herzchen verteilen, dies alles führt zu dokumentierten Beziehungen spiegelt eine persönliche Kultur vor, die mit einer Öffentlichkeit oder öffentlichen sozialen Beziehungen nichts zu tun haben, weil die elektronische Kontaktaufnahme flüchtig ist, jederzeit einen Rückzug bietet und nur wenig Maß an Verantwortung für die neue Beziehung erfordert. – Warum wird ein Kontaktwunsch geäußert? Will man seine eigene Liste der der Bekannten auffüllen, will man selbst bekannter werden? Wie viele Kontakte verkraftet man? Einem Kontaktwunsch nicht zu entsprechen ist ganz einfach, dem Gegenüber wird das nicht mitgeteilt. Wir erlauben bei dieser Art von Spielchen, dass eine dritte Instanz, unser Verhältnis, das noch gar keines ist, regelt. Das ist nur ein kleiner Teilaspekt in einem ganzen Netzwerk, wo nicht nur mein Kontakt, sondern der Betreiber des Netzwerks und sogar die Netzwerk-Gemeinschaft in die Gestaltungsmöglichkeiten meiner Kontaktverhältnisse eingreift. Überlegt man wie viele Arten von Regeln die Foren bestimmen, erscheint der persönliche Gestaltbarkeit einer Kontaktanbahnung merkwürdig stark eingeengt.
Nehme ich den Gegenüber nur aufgrund seiner von ihm angezeigten Qualitäten wahr? Ist nicht eine Person gerade deshalb so interessant, weil sie in einer bestimmten Situation so wunderbar individuell und unverwechselbar, einmalig reagiert, etwas das ihr Profil nie wiedergeben wird. Die Menschen stellen ihr Profil ins Netz und werden dabei seltsam anonym. Kein Profil in sozialen Netzwerken erlaubt eine Gewichtung der persönlichen Interessen in einem Profil. Ist auch nicht nötig, das Profil gibt für alle die gleiche Form, schließlich will sich jeder Besucher gerne usability-gerecht auf jeder Seite gleich gut zurechtfinden. Was dabei herauskommt ist eine Uniformisierung, deren Folgen noch im Dunkeln liegen.
 Vielleicht kann man sich diesem Problem auf dem Umweg über die Stadtarchitektur oder -planung annähern. Betrachten wir nacheinander zwei Plätze, die den Raum für öffentliches Leben bilden sollen. Der Wihelmsplatz (I) in Stuttgart-Bad-Cannstatt (> Eine Ortsbesichtigung) ist das erste Beispiel. Hier ist es gründlich misslungen, einen öffentlichen Raum für die Begegnung von Menschen zu schaffen. Offenkundig engen eine Vielzahl von Vorschriften jeder Art die Wege der Menschen auf einen engen Raum ein, während die anderen Verkehrsteilnehmer ihre eigenen Verkehrsräume erhalten haben.
Vielleicht kann man sich diesem Problem auf dem Umweg über die Stadtarchitektur oder -planung annähern. Betrachten wir nacheinander zwei Plätze, die den Raum für öffentliches Leben bilden sollen. Der Wihelmsplatz (I) in Stuttgart-Bad-Cannstatt (> Eine Ortsbesichtigung) ist das erste Beispiel. Hier ist es gründlich misslungen, einen öffentlichen Raum für die Begegnung von Menschen zu schaffen. Offenkundig engen eine Vielzahl von Vorschriften jeder Art die Wege der Menschen auf einen engen Raum ein, während die anderen Verkehrsteilnehmer ihre eigenen Verkehrsräume erhalten haben.




Die Fußgänger werden auf diesem Platz nur insoweit geduldet, wie sie ihn zwischen den Laufgittern schnell zu überqueren bereit sind. Es ist kein Platz zum Verweilen. Als Zentrum eines Ortsteils hat er seine Funktion verloren.


In ähnlicher Weise funktionieren die sozialen Netzwerke wie Facebook u.a. im Internet. Trotz einer immer größeren Fülle von Funktionen, die für die Selbstdarstellung eine Vielzahl von Möglichkeiten anbieten, ist das Schema der Kontaktaufnahme durch die Gestalter dieser Netzwerke weitgehend vorgeschrieben, eben so wie auf einem Platz, auf dem die Menschen in vorbestimmten Bahnen sich bewegen müssen. Was einem auf diesem Platz einfällt? Wie werden die Passanten diesen Stadtraum wieder für sich zurückerobern können?
Gute Frage, gerade an so einem Wochenende, an dem die Ulmer Bürger das Museum Weishaupt in > Ulms Neuer Mitte, > Drei neue Gebäude, eingeweiht haben.

Foto (c) Stadt Ulm. Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Ulm.
Das neue Museum liegt direkt an dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz, mit dem die Ulmer in sehr beeindruckender Weise die Kriegswunden der Stadt, an die die Neue Straße noch bis vor kurzem erinnerte, zwischen Münster und Altstadt endlich wieder geschlossen haben.
Abgesehen von dem offensichtlichen Nutzen, die soziale Netzwerke unbestreitbar bieten, darf dennoch, die Funktion und der Aufbau dieser Angebote kritisch hinterfragt werden.
Zum zweiten Beispiel: > La Place de l’Homme de fer in Straßburg
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (I)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (II)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (III)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (IV)
Der Beitrag wurde am Sonntag, den 25. November 2007 um 23:13 Uhr veröffentlicht und wurde unter Plätze, Soziologie, Stadtplanung, Veranstaltungen abgelegt. Du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seite einrichten.