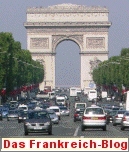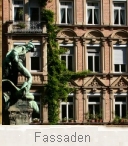Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (III)
25. November 2007 von H. Wittmann
Le deuxième exemple est la > place Homme de fer à Strasbourg. A peine les tramways, qui viennent ici de quatre directions, ont-ils glissé, que les passants reprennent le contrôle de la place. Le tram n’est ici qu’un invité, il est toléré, il peut sonner, on lui fait de la place pour passer.




Les réseaux sociaux du type connu incitent les gens à révéler le plus possible leur identité ; plus ils sont nombreux, plus on leur promet de meilleures chances de contact avec les autres, directement ou indirectement, afin qu’ils remplissent toujours plus de champs. Je suppose qu’en dépit de la véracité des informations fournies, ces réseaux créent un monde fictif qui n’a rien à voir avec la vie publique.
La vie publique et les relations entre les personnes impliquent la découverte de l’autre sous toutes les formes de respect. Respect de l’intégrité individuelle, respect des attitudes personnelles, telles sont les règles du jeu qui régissent la façon dont les gens se rencontrent entre eux. La rencontre furtive, l’échange de cartes de visite, la reprise de contact qui s’ensuit et qui permet de poursuivre la découverte de l’autre, n’existent plus.
Seuls des espaces urbains dans lesquels les passants se rencontrent sans être entravés par des barrières de toutes sortes – nous ne discutons pas ici de l’utilité des prescriptions techniques de circulation qui conduisent à des places obstruées – peuvent donner naissance à un public. Les places qui ont perdu leur fonction initiale de rencontre n’ont plus d’utilité pour une société urbaine.
Les réseaux sociaux, qui n’ont pas de barrières en apparence, enlèvent de nombreuses dimensions à la connaissance en tant que processus social, c’est comme si l’on piochait dans les cartes de l’autre, si l’on a trouvé entre-temps des informations sur l’autre dans un réseau. La durée de la connaissance a été avancée de plusieurs semaines, avec quelle légèreté on ne fait que comparer avec ses propres intérêts, les facettes intéressantes de l’autre sont mal évaluées dans leur individualité ou ne sont même pas reconnues.
La deuxième thèse est donc, en se rapprochant de Richard Sennett (Déclin et fin de la vie publique. La tyrannie de l’intimité, en anglais The Fall of Public Man, Francfort/M. 1983), que les réseaux sociaux ne sont en aucun cas sociaux, mais qu’ils contribuent considérablement et de manière décisive au déclin de la sphère publique, précisément en faisant semblant d’être publics. Plus l’identité commune est constatée ou développée, plus tous deviennent égaux, pourrait-on ajouter, plus la poursuite d’intérêts communs devient impossible, explique Sennett (p. 295). Ce n’est pas forcément aussi paradoxal qu’il y paraît. Seules les différences font naître la curiosité et conduisent à la découverte de quelque chose de nouveau.
> Stadtplanung und soziale Netzwerke (IV)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (I)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (II)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (III)
weiter mit : > Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (IV)
Das zweite Beispiel ist der > Platz Homme de Fer in Straßburg. Kaum sind die Straßenbahnen, die hier aus vier Richtungen kommen, vorbeigeglitten, übernehmen wieder die Passanten die Herrschaft über den Platz. Die Bahn ist hier nur Gast, sie wird geduldet, sie darf klingeln, man macht ihr für die Durchfahrt Platz.




Soziale Netzwerke der bekannten Art verführen die Menschen zu einer möglichst weitgehenden Preisgabe ihrer Identität, je mehr, um so bessere Kontaktchancen mit anderen werden direkt oder indirekt versprochen, damit immer mehr Felder ausgefüllt werden. Ich vermute, daß trotz der wohl oft zutreffenden Angaben in diesen Netzwerken dennoch eine Scheinwelt aufgebaut wird, die mit dem öffentlichen Leben nichts zu tun hat.
Zum öffentlichen Leben und Umgang miteinander gehört die Entdeckung des Anderen unter allen Formen der Wahrung des Respekts. Respekt vor der individuellen Integrität, Respekt vor persönlichen Einstellungen, so lauten die Spielregeln, wie Menschen sich untereinander begegnen. Das flüchtige Kennenlernen der Tausch der Visitenkarten, die folgende erneute Kontaktaufnahme, mit der das Entdecken des Anderen fortgesetzt werden kann, gibt es nicht mehr.
Nur städtischen Räumen, in denen die Passanten sich einander begegnen ohne die Einengung durch Barrieren aller Art – hier wird nicht über den Nutzen der verkehrstechnischen Vorschriften, die zu verbauten Plätzen führen diskutiert – kann eine Öffentlichkeit entstehen. Plätze, die ihre ursprüngliche Funktion der Begegnung verloren haben, haben auch für eine Stadtgesellschaft erstmal keinen Nutzen mehr.
Soziale Netzwerke, die nur augenscheinlich keine Barrieren haben, nehmen dem Kennenlernen als sozialen Prozeß viele Dimensionen, es ist wie ein Spicken in die Karten des gegenüber, wenn man zwischenzeitlich in einem Netzwerk Informationen über den Anderen gefunden hat. Die Dauer der Bekanntschaft ist um Wochen vorgespult worden, wie leichtfertig wird nur ein Abgleich mit den eigenen Interessen vorgenommen, interessante Facetten des Gegenübers werden in ihrer Individualität falsch gewichtet oder gar nicht erst erkannt.
Die zweite These lautet also, in Annäherung an Richard Sennett (Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität, engl. The Fall of Public Man, Frankfurt/M. 1983), daß die sozialen Netzwerke keinesfalls sozial sind, sondern zum Niedergang der Öffentlichkeit gerade durch die Vorspiegelung der Öffentlichkeit erheblich und entscheidend beitragen. Je mehr gemeinsame Identität festgestellt oder entwickelt wird, je gleicher alle werden, so möchte man hinzufügen, so unmöglicher wird die Verfolgung gemeinsamer Interessen, erklärt Sennett (S. 295). Das ist nicht unbedingt so paradox, wie es klingt. Nur die Unterschiede lassen die Neugier entstehen und führen zum Entdecken von Neuem.
> Stadtplanung und soziale Netzwerke (IV)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (I)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (II)
> Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (III)
weiter mit : > Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 2.0 (IV)
Der Beitrag wurde am Sonntag, den 25. November 2007 um 23:15 Uhr veröffentlicht und wurde unter Plätze, Soziologie, Stadtplanung, Veranstaltungen abgelegt. Du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seite einrichten.