Ergänzt am 26.2.2009
Ergänzt am 1.3.2009
Ergänzt am 1.3.2009 – 2 –
Ergänzt am 1.3.2009 – 3 –
Noch hat niemand sich hier niemand in Form eines Kommentars für die Untertunnelung ausgesprochen. Vergleicht man das mit den Besucherzahlen auf dem Blog, entsteht der Eindruck, niemand liebe den Tunnel. 1.3.09
Auf dem Gang zum Rathaus, um die Ausstellung mit den Entwürfen für die Untertunnelung der Konrad-Adenauer-Straße, also der Kulturmeile zwischen Landtag, Oper auf der einen Seite und der Landesbibliothek und Staatsgalerie auf der anderen Seite, anzusehen, kam ich wieder mal am > Charlottenplatz vorbei. Ein Blick Richtung Hauptstätterstraße:

Wieviel Prozent der Autos brausen wohl die ganze Strecke dieser vierspurigen Stadtautobahn vom Neckartor bis zur Filderstraße durch? 50 % oder weniger? Jedenfalls werden die zweispurigen Auf- und Abfahrten sehr rege genutzt, man hat den Eindruck, kaum 30 oder 40 % fahren die ganze Strecke, vielleicht noch weniger. Und wieviele bloße Hin- und Herfahrer – Verkehrsteilnehmer, die gerne im rechten Winkel zur Stadtautobahnrisen würde – gibt es, die die Stadtautobahn gerne im Auto überqueren möchten, aber erst eine U-Turn-Möglichkeit finden müssen, um auf der anderen Seite wieder zurückfahren zu können? Für diese Auf- und Abfahrer wurden zusätzliche Spuren, Verzögerungs- (die heißen nur so, denn Sie werden auf diesen Spuren ja doch meistens überholt!) und Beschleunigungsspuren, Zu- und Auffahrten eingerichtet, damit sie den Verkehrsstrom nicht stören. Dennoch > 14 Spuren sind zuviel.
Der Blick in die Konrad-Adenauerstraße regt zu den gleichen Überlegungen an:

Rechts im Bild, die beiden Spuren, die eines Tages in den Tunnel unter die Kulturmeile gelegt werden, links ein Teil des Verkehrs, der dann immer noch oben rollen wird, damit er weiterhin am Charlottenplatz nach Degerloch abbiegen kann. Leider haben die meisten Entwürfe, den verbleibenden Verkehr (sondern nur viele Bäume!) nicht dargestellt. Eine echt interessante Lösung konnte ich unter keinem der Entwürfe entdecken. Es geht vielleicht auch gar nicht, denn alle beteiligten Stadtplaner scheinen recht ratlos zu sein, was man denn mit dem freigewordenen Raum machen kann. Den meisten kommen Bäume im Sinne von Straßenmobilar in den Sinn, die hier im Fall der Konrad-Adenauer-Strasse zu echten Lückenbüßer werden, statt dazubeizutragen, zwei getrennte Stadtteile auf stadtarchitektonische Weise wieder gekonnt miteinander zu vereinen. Heute ist die Kulturmeile total verkorkst, und die aktuellen Planung lassen nichts Gutes erhoffen. Kultur läßt sich nicht mit einem Überweg zwischen Oper und Staatsgalerie schaffen.
> Kulturmeile. Wettbewerb in Stuttgart entschieden:
1. Preis, 35.000 Euro: Lützow 7 Garten- und Landschaftsarchitekten, Cornelia Müller, Jan Wehberg, Berlin, in Arbeitsgemeinschaft mit Auer + Weber + Assoziierte, Christof Teige, Stuttgart
Die Ausstellung mit den Arbeiten steht noch bis Freitag, 27. Februar 2009, im Rathaus Stuttgart, 3. OG.
Die Kultur muss selbst die Oberhand gewinnen und die Planung übernehmen. Je mehr man darüber nachdenkt, um so mehr wird deutlich, dass der Versuch, die Kulturmeile aufzuhübschen, ein hoffnungsloses Unterfangen ist, besonders dann, wenn man einen Teil des Verkehrs unter der Erde verstecken will. Man versteckt ihn aber nur in situ, tatsächlich zieht eine solche Lösung noch mehr Verkehr an, weil suggeriert wird, hier rollt es sich bequem. Noch mehr Raser werden den Tunnel benutzen und oft gänzlich unbewusst Umwege zum eigentlichen Ziel in Kauf nehmen. So konsequent und radikal man über den Bahnhof und S21 nachdenkt, so halbwegs konsequent müsste man auch über die Stadtautobahn nachdenken, die Stuttgarts größtes Innenstadtübel ist. So wie man über den Abriss der Paulinenbrücke nachsinnt, die auch die Schließung und Abriss des Elefantenklos am Österreichischen Platz zur Folge haben müsste, so wäre wirklich auch eine Gesamtlösung für die Stadtautobahn notwendig. Alle meine Gesprächspartner sagen dann immer, wo soll denn der ganze Verkehr dann hin? Sich verteilen. Denn der Verkehr kommt nur in dieser Masse, weil die Stadtautobahn da ist. S. die Zahlen am Ende dieses Beitrags.
Eine Art Ansaugrohr für den Verkehr unter der Kulturmeile überzeugt nicht, weil oben immer noch so viele Autos rollen werden. Gibt es zuverlässige Untersuchungen über die Zusammensetzung der Verkehrsflüsse auf diesem Stadtautobahnabschnitt? Wieviel Prozent sind echte Durchfahrer, die auf der Stadtautobahn nicht abbiegen möchten? Müssen die wriklich durch Stuttgart brausen? Wieviel Prozent sind Abschnittsfahrer, die die Stadtautobahn nur nehmen, weil es vermeintlich vielleicht schneller geht, um an ein innerstädtisches Ziel zu gelangen, das gar nicht im Bereich der Stadtautobahn liegt? Zwischendurch ziehen wir schon mal 30 Prozent Hin-und Herfahrer ab, unten Ihnen die, die z. B. von Degerloch kommend beim Landtag vorfahren wollen, am Gebhard-Müller-Platz den U-Turn machen müssen.
> Städtebaulicher Ideen- und Realisierungswettbewerb Konrad-Adenauer-Straße Stuttgart www.competitionline.de
Warum traut man sich nicht an eine > Gesamtlösung für die Stadtautobahn heran?
> Vorrang für die Autos auf 10 Spuren
> Ulm Neue Mitte – Die Rückeroberung des Stadtraums oder was geschieht mit der Hauptstätter Straße in Stuttgart?
> Gehen wir weiter zum Gebhard-Müller-Platz heißt der Beitrag, der über die Gesamtlösung für die Stadtautobahn vom Neckartor bis zum Marienplatz/Der Stadtboden gehört allen berichtet, die Professor Roland Ostertag vorgeschlagen hat. Auch sein Entwurf sieht Bäume vor – aber keinen Tunnel. Und wo sollen die Autos bleiben? werde ich immer wieder gefragt? Also nochmal:
40 Prozent sind Hin-und Herfahrer (s.o.)
30 Prozent nutzen die Stadtautobahn, weil es sie gibt, ohne sie
würden sie den Zielort ihrer Fahrt direkt ansteuern
30 Prozent sausen wirklich von der Filderstraße bis zum Neckartor auf der Stadtautobahn
und gehören eigentlich nicht in die City
20 Prozent machen ohnehin Fahrten unter 3 oder 4 Km
120 % – das sind nur Schätzungen, aber diese Größe legt nahe, dass wir diese Stadtautobahn nicht brauchen und schon gar nicht den Tunnel, denn Tunnel brauchen Ein- und Ausfahrten, die für den Stadtboden gestaltungsmäßig verloren sind.
Wer braucht eigentlich wirklich die Stadtautobahn, und für wen wird der Tunnel für so viele Millionen gebaut?
Thomas Borgmann, > Kulturmeile droht an Finanzierung zu scheitern, Stuttgarter Zeitung, 20. Februar 2009.

 Gestern haben die Student in Stuttgart gegen die Pläne der Uni, die Geisteswissenschaften zu kürzen ( >
Gestern haben die Student in Stuttgart gegen die Pläne der Uni, die Geisteswissenschaften zu kürzen ( > 
 Ein Buch, das einem Stuttgart näher ans Herz bringt: Anna Katharina Hahn gibt der Stadt in „Kürzere Tage“ Struktur und Profil, macht sie lesbar und liebenswert. Es ist eine pointierte Darstellung verschiedenster Milieus, die sich wohl in keiner deutschen Stadt so abspielen kann wie in Stuttgart – in der gedrängten Kessellage der Stadt, die „einen behäbigen Frieden atmet“, treffen Reich und Arm auf engstem Raum aufeinander.
Ein Buch, das einem Stuttgart näher ans Herz bringt: Anna Katharina Hahn gibt der Stadt in „Kürzere Tage“ Struktur und Profil, macht sie lesbar und liebenswert. Es ist eine pointierte Darstellung verschiedenster Milieus, die sich wohl in keiner deutschen Stadt so abspielen kann wie in Stuttgart – in der gedrängten Kessellage der Stadt, die „einen behäbigen Frieden atmet“, treffen Reich und Arm auf engstem Raum aufeinander. 


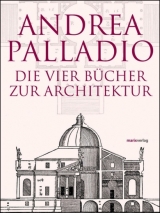
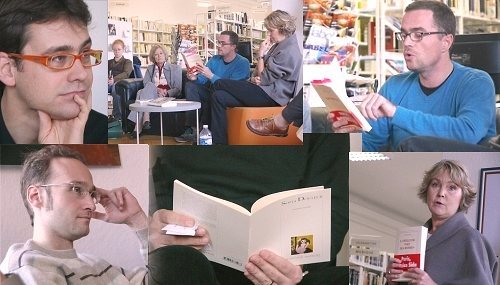




 nach rechts und links in das Stadtgebiet reichen können? Aber da es die Stadtautobahn nun mal gibt, kann man nicht einfach so mal abbiegen. Als Folge verwaisen die Nebenstraßen, hier die Straße neben dem Geschichtsmuseum, die dann für die Fußgänger zur Rutschbahn und für die Autos zum Parkplatz wird. Leerer, nicht oder schlecht genutzter Stadtraum, wie an so vielen anderen Stellen beiderseits der Stadtautobahn.
nach rechts und links in das Stadtgebiet reichen können? Aber da es die Stadtautobahn nun mal gibt, kann man nicht einfach so mal abbiegen. Als Folge verwaisen die Nebenstraßen, hier die Straße neben dem Geschichtsmuseum, die dann für die Fußgänger zur Rutschbahn und für die Autos zum Parkplatz wird. Leerer, nicht oder schlecht genutzter Stadtraum, wie an so vielen anderen Stellen beiderseits der Stadtautobahn.