Wenn sich die Leser die Grafik ansehen, die die Lage des neuen teilweise eingebuddelten und um 90 Grad gedrehten hinterm Bonatzbau versteckten und in den Schloßpark eingefügten Hauptbahnhofs mit dem Geflecht der Zu- und Ab-Tunnelröhren unter den Stuttgarter Bergen anzeigt, werden manche von ihnen nur noch den Kopf schütteln. Ich kenne auch Befürworter, die wissen gar nicht, dass die Schienen künftig ungefähr so in etwa unter der heutigen Wandelhalle verlaufen sollen. Ein Schwabenstreich? Ein 33 Kilometer langes Tunnelnetz soll gebaut werden – obwohl viele überirdische > Stadtreparaturen viel wichtiger wären. Da kann es auch kaum beruhigend wirken, dass der Gesamtprojektleiter Hany Azer meint, man müsse erst mal eine Baugrube ausheben, dann werde sich das Meinungsbild ändern, so wird er heute in der Stuttgarter Zeitung zitiert. Nutzen – etwas schneller irgendwohin -, Annehmlichkeit oder gar Schönheit, die das Denken von Städteplanern auszeichnen könnte und sollte sind außer der Dauerhaftigkeit hinsichtlich der zu erwartenden Baustellen und auch der Kosten nicht so recht zu entdecken.
Der Tunnel und seine Problemzonen. Anhydrit? Hany Azer ist sich sicher: „Das kriegen wir in den Griff,“ zitiert ihn die SZ von heute. Man würde das ganze Projekt vielleicht anders beurteilen, wenn es ein echtes Gesamtkonzept für Stuttgart gäbe. In welche Beziehungen wird der neue Untergrundbahnhof zur unmittelbaren Innenstadt treten? Was steht im Vordergrund? Die Ankunft der Reisende in der Landeshauptstadt in einem Kopfbahnhof mit 16 Gleisen unter einer großzügigen Glashalle oder ihr unterirdisches schnelles Vorbeibrausen auf 8 Gleisen, die unterhalb der Rolltreppen und Aufzüge liegen ? Das Projekt ist den Bürgern bisher nie richtig erklärt worden. Man versucht, Tatsachen zu schaffen, um möglichst bald den Punkt zu erreichen, an dem man nicht mehr zurück kann? Woher wohl die Zuversicht stammt, dass alles gut werde, wenn die Bürger über die ersten Baustellen stolpern? Vielleicht habe ich auch hier und da Argumente der Befürworter übersehen oder nicht gefunden. Gucken wir uns doch zur Beruhigung Grundlagen der Architektur an:
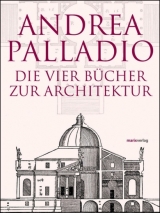 Hans-Karl Lücke, emeritierter Professor für Kunstgeschichte hat im marixverlag Andrea Palladios I quattri libri dell’architettura / Die vier Bücher über die Baukunst neu herausgegeben. Die Ausgabe vereint den Text der 1570 in Venedig erschienenen Ausgabe, die Zeichnungen mit der deutschen Übersetzung des Textes, die ebenfalls vom Herausgeber stammt.
Hans-Karl Lücke, emeritierter Professor für Kunstgeschichte hat im marixverlag Andrea Palladios I quattri libri dell’architettura / Die vier Bücher über die Baukunst neu herausgegeben. Die Ausgabe vereint den Text der 1570 in Venedig erschienenen Ausgabe, die Zeichnungen mit der deutschen Übersetzung des Textes, die ebenfalls vom Herausgeber stammt.
Dieses Traktat über die Architektur enthält einige grundlegende Bemerkungen, die den so entschiedenen Befürwortern von Stuttgart 21 und dem damit verbundenen Umbau des Hauptbahnhofs in Erinnerung gerufen werden sollten.
Im Kapitel Eins des ersten Buchs „Was man bedenken sollte, bevor man sich ans Werk macht“ stehen Lehrsätze, die Palladio mit Bezug auf Vitruv, aber auch als Mahnung an künftige Architekten formuliert hat: „Drei Dinge müssen, wie Vitruv sagt, bei jedem Bau berücksichtigt werden, ohne die kein Bauwerk gelobt zu werden verdient, und zwar der Nutzen (utile) oder Annehmlichkeit (commodità), die Dauerhaftigkeit (perpetuità) und die Schönheit (belleza). Auch Anmut (grazia) sollte das Gebäude besitzen. Vielleicht ist s auch nur einfach der gesunde Menschenverstand, der sich gegen den Abriss der Seitenflügel des Stuttgarter Hauptbahnhofs sträubt. Aus 16 Gleisen werden viel weniger Gleise, man muss da untern auf die vorbeirauschenden Züge warten, anstatt vom Zug am Bahnsteig abgeholt zu werden. Die Züge bringen die Reisenden nicht mehr in die Stadt, sondern laden sie im Vorbeifahren im Tunnel aus. Das ist kein Ankommen mehr, der Reisende wird abgeliefert. Keiner der Grundsätze Vitruvs scheint bei der Planung von S 21 beachtet worden zu sein..
Das Kapitel VII behandelt die „Beschaffenheit des Bodens, in dem die Fundamente liegen sollen“. Da denkt man doch gleich an die vielen Mineralquellen und die Tunnelbohrungen unter und durch die Stuttgarter Berge. Im Dritten Buch geht es im 2. Kapitel um die „Anlage der Straßen in der Stadt“, da fällt mir gleich wieder die Hauptstätter Straße ein, über die auf diesem Blog schon hinreichend geklagt worden ist. In den vielen anderen Kapitel über Säulen, Säle und Atrien geht es immer wieder um die Einheit der Bauwerke in sich, durch die deren Harmonie mit ihrer Umgebung definiert werden soll. Das Kapitel XVI im dritten Buch nennt ein wichtiges Thema für die Stadtentwicklung: „Von den Plätzen und den Gebäuden, die sie umgeben“ oder wie sprechen die Gebäude zu ihrer Umgebung? Betrachtet man die Anfänge von S 21, so ist davon kein Laut zu hören. Und was wird die neue Bibliothek des 21. Jahrhunderts zu ihrer Umgebung sagen? „Da bin ich…“ ? Oder die anderen Gebäude sagen: „Was willst Du hier?“ Das erste Kapitel des vierten Buches „Vom Platz, den man für den Bau eines Tempels wählen sollte“ enthält ebenfalls Wichtiges und Erhellendes zu diesem Thema.
Stuttgart hat aber keine richtige > Platzkultur. Diese beschränkt sich auf den Schlossplatz, den Karlsplatz und den Schillerplatz. Vom > Bahnhofsvorplatz hört man in Zusammenhang mit S 21 gar nichts oder nur das Brausen der vorbeirasenden Autos oder das Tuckern der Motoren, wenn wieder mal alles vorm Bahnhof steht.
Andrea Palladio
> Die Vier Bücher zur Architektur
Zweisprachig Italienisch-Deutsch, im Originalformat mit sämtlichen Tafeln. Herausgegegeben und neu übersetzt von neu Hans-K. Lücke.
480 S., gebunden mit Schutzumschlag, 31,2 x 23,5 cm
Die erste Auflage ist vergriffen.
Die zweite Auflage erscheint am 21.01.2009.
Konstantin Schwarz, > Perspektive für die Stadtentwicklung, Stuttgarter Nachrichten 20. Juli 2007 (*.pdf)
> Bahnprojekt Stuttgart–Ulm – „Das neue Herz Europas“
> kopfbahnhof-21.de/


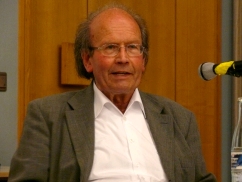 Pfarrer Müller begrüßte Roland Ostertag. In dem folgenden Vortrag wurden mit den Bemerkungen zur 1. und 2. Stadtzerstörung, womit die Auswirkungen des Wiederaufbaus in der City gemeint sind, einige kritische Fragen zur Stadtentwicklung seit 1945 gestellt. Angesichts neuerer Entwicklungen und der aktuellen Stadtplanung, darf, so Ostertag, danach gefragt werden, wie heute auf Stadtgängen die Seele der Stadt entdeckt werden kann.
Pfarrer Müller begrüßte Roland Ostertag. In dem folgenden Vortrag wurden mit den Bemerkungen zur 1. und 2. Stadtzerstörung, womit die Auswirkungen des Wiederaufbaus in der City gemeint sind, einige kritische Fragen zur Stadtentwicklung seit 1945 gestellt. Angesichts neuerer Entwicklungen und der aktuellen Stadtplanung, darf, so Ostertag, danach gefragt werden, wie heute auf Stadtgängen die Seele der Stadt entdeckt werden kann.













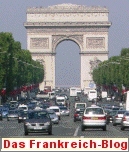



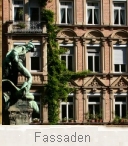


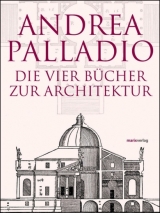






 Il est peut-être possible d’aborder ce problème par le biais de l’architecture ou de la planification urbaine. Considérons successivement deux places qui doivent constituer l’espace de la vie publique. La Wihelmsplatz (I) à Stuttgart-Bad-Cannstatt (>
Il est peut-être possible d’aborder ce problème par le biais de l’architecture ou de la planification urbaine. Considérons successivement deux places qui doivent constituer l’espace de la vie publique. La Wihelmsplatz (I) à Stuttgart-Bad-Cannstatt (> 





